|
|

"Am
Rande des Imperium" Limesmuseum Aalen
|

"Der Limes",
Die Deutsche Limes-Straße vom Rhein bis zur Donau
- Theiss Verlag
|
 Weitere Empfehlungen/Buchtipps
Weitere Empfehlungen/Buchtipps |
|
|
|
|
|
|
Übersichtskarte
zum Limes-Verlauf  |
|

|
Der
Obergermanisch-Rätische Limes war die mehr als 500 km
lange Grenzbefestigung, die den Rhein mit der Donau
verband. Er reichte von Rheinbrohl/Bad Hönningen am
Rhein bis nach Hienheim bei Eining an der Donau. Am
Limes standen mindestens 900 Wachtürme und rückwärtig
der Grenzlinie über sechzig größere Kastelle, wobei
drei davon Legionslager waren, sowie einige hundert
sogenannte Kleinkastelle (weniger als 100 Mann
Besatzung). Er ist damit das größte archäologische
Geländedenkmal Mitteleuropas.
|
|
[59]
Der Verlauf des gesamten Limes |
|
 Vergrößerung
der Karte Vergrößerung
der Karte
|
|
| |
Funktion
und Bauphasen des Limes  |
|
Ursprünglich
bedeutete das Wort Limes Weg, Besitzgrenze oder auch in
den Wald geschlagene Schneise. Die Vorläufer des
späteren befestigten Limes waren eben jene Grenzwege
oder Waldschneisen, die zur Markierung des
Grenzverlaufes dienten. Den durchgehenden Limes vom
Rhein bis zur Donau gab es erst in der Mitte des 2.Jrh.
und er war das Ergebnis zahlreicher vorangegangener
Grenzkorrekturen.
|
|
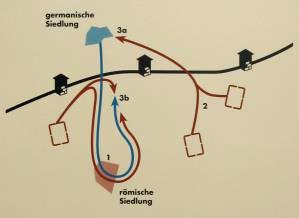
Römische
Taktik am Limes
|
Der Limes
ist mit Sicherheit nicht als Verteidigungsanlage
gedacht. Er sollte in erster Linie den Grenzverlauf klar
markieren (Zollgrenze) und es kleineren Stammesgruppen,
die in den römischen Provinzen auf Raubzüge aus waren,
schwer machen unbemerkt die Grenze zu verletzen. Auch
war der Rückweg mit Raubgut beladen wesentlich
erschwert, wenn nicht gar unmöglich. Man kann auch
sagen, der Limes trennte eine reichere von einer
ärmeren Region (ähnlich der heutigen EU-Außengrenze).
Wurde von den Wachtürmen aus eine Grenzverletzung
entdeckt (1), wurde der Alarm mittels Rauchzeichen,
Feuer- oder Hornsignalen an die nächstgelegenen
Kastelle weitergegeben.
|
|
So konnten
die Soldaten dort ausrücken (2) und die feindlichen
Horden aufspüren und vertreiben oder festsetzen (3a,
3b). Handelte es sich um einen größeren Angriff, so
konnte im Ausnahmefall die nächstgelegene
Kohorte/Legion ausrücken.
|
|
|
|
|
|
| 1.
Bauphase im 1.Jrh |
2.
/ 3. Bauphase um 130 / 170 |
 |
Waldschneise
mit Patrouillenweg und hölzernem Wachturm. |
 |
Zuerst
wurde eine zusätzliche hölzerne Palisadenwand
errichtet. Um 170 wurden die inzwischen
baufälligen Holztürme dann durch Steintürme
ersetzt. |
| [59] |
|
[59] |
|
4.
Bauphase in Obergermanien
Ende 2. / Anfang 3. Jrh. |
4.
Bauphase in Raetien
Ende 2. / Anfang 3. Jrh. |
 |
Weitere
Verstärkung der Palisadenwand durch einen
Wall mit vorgelagertem Graben. |
 |
Errichtung
einer durchgehenden, die Türme
miteinschließenden 1 bis 1,20 m breiten
Steinmauer. |
| [59] |
|
[59] |
|
| |
|
|
|
|
|
Geschichte
des Limes  |
| 81
- 96 |
Unter
Kaiser Domitian wurde erstmals der Plan einer
zusammenhängenden Grenzbefestigung gefasst. Noch
während des Krieges gegen die germanischen Chatten (83
bis 85 n.Chr.) begannen die Römer erste Schneisen in
die damals noch sehr dichten Wälder zu schlagen und
legten Patrouillenwege an. Im Verlaufe des 1.Jrh. wurden
die Grenzlinien im süddeutschen Raum immer mehr
Richtung Nordosten vorgeschoben, um eine möglichst
kurze Verbindungsstraße zwischen dem Nieder- und
Mittelrhein und den Donauprovinzen zu schaffen |
| um
100 |
Bau
des Limes in der Wetterau und im Odenwald (heutiges
Hessen) unter Kaiser Trajan sowie Anlage erster Kastelle
am Neckar und auf der schwäbischen Alb zur Absicherung
der Verbindungsstaße. |
| um
130 |
Errichtung
einer durchgehenden Limespalisade vor den
Patrouillenwegen. |
| 145 |
Kastelle
am Neckar und im Odenwald werden in Stein ausgebaut. |
| um
155 |
Südlich
des Main wird der Limes vorverlegt auf die Linie
Miltenberg-Lorch-Aalen. Das Kastell in Aalen wird
gegründet. |
| um
170 |
Ersatz
der anfänglichen hölzernen Türme durch Wachtürme aus
Stein. |
| 179 |
Errichtung
des Legionslager in Castra Regina (Regensburg) |
| um
200 |
Ausbau
des Limes mit Wall und Graben in Obergermanien und
Errichtung der Limesmauer in Raetien |
| 213 |
Ausbau
des Limestores bei Dalkingen. |
| ab
233 |
Ständige
Bedrohung des Limesgebietes durch die Germanen. |
| 242 |
Alamannen
durchbrechen den raetischen Limes im Osten Bayerns und
zerstörten die Kastelle Gunzenhausen, Kösching und
Künzing. |
| 255 |
Kaiser
Gallienus verstärkt die Rheinarmee durch Abteilungen
des britannischen Heeres und besiegt die angreifenden
Germanen. Bis zum Jahre 260 schlägt Kaiser Gallienus
wenigstens noch fünfmal die Germanen zurück. |
| 258 |
Die
pannonischen Legionen rufen Ingenuus zum Kaiser aus.
Kaiser Gallienus maschiert gegen Ingenuus mit Truppen
vom Rhein. |
| 259
/ 260 |
Der
Abmarsch der römischen Truppen vom Rhein nach Pannonien
ist für die Germanen erneut das Signal zum Aufbruch und
Franken und Alamannen fegen 259/60 n. Chr. die
römischen Grenzwachen hinweg und stoßen über Rhein
und Donau weit nach Westen und Süden vor. |
| 260 |
Mit
der Besetzung durch die Alamannen geht das Limesgebiet
verloren. |
| 260
/ 261 |
Kaiser
Gallienus besiegt zwar mit den rheinischen und
raetischen Truppen die Alamannen bei Mailand, aber die
Grenzlinie zwischen Rhein und Donau ist endgültig
zerschlagen. |
|
|
|
|
|
|
Kastelle
am Limes  |
| Aufbau |
| Die aus
militärischer Sicht wichtigsten Einrichtungen am Limes waren
die Kastelle. Marschlager wie Standlager (und dazu zählen
auch die Kastelle) wurden immer nach einem einheitlichen
Grundmuster angelegt. Abgesehen von den Marschlagern des
Drusus in Germanien waren die Standlager größtenteils
rechteckig, wobei die Seitenkanten ein Verhältnis von 2:3
haben sollten. |
|
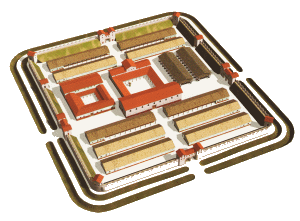
[59]
Idealisiertes Limeskastell
|
Die
vier Tore lagen sich paarweise gegenüber und wurden von
sich in der Mitte kreuzenden Straßen verbunden, der via
praetoria und der via principalis. Genau über den
Kreuzungspunkt befand sich die basilica des
Stabsgebäudes (principia).
 Typischer Grundriss eines Auxiliarkastell
Typischer Grundriss eines Auxiliarkastell
Die Kastelle hatten am Obergermanisch-Raetischen Limes
untereinander etwa einen Abstand von 8 -10 km. Die hier
stationierten Truppen stellen auch die Besatzungen in
den Wachtürmen in der Nähe sowie für
Patrouillengänge.
|
| |
|
| Typische
Gebäude eines Lager oder Kastell (Innenbauten) |
|
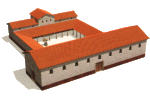
[59]
|
Principia
(Stabsgebäude)
Die via
praetoria (Straße zum Haupttor porta praetoria)
führte direkt auf den Eingang dieses Gebäude.
Die große Halle (basilica) lag genau auf dem
Schnittpunkt der zwei großen Lagerstraßen und
diente für Truppenapelle und Exerzierübungen bei
schlechtem Wetter. In der principia befanden
sich desweiteren die Diensträume des Kommandeurs,
die Schreibstuben der Verwaltung (tabularia), die
Waffenkammern (armamentaria) und das
Fahnenheiligtum (aedes). Unter den Fahnenheiligtum
im Keller war die Truppenkasse untergebracht. |
|
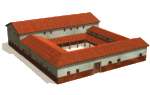
[59]
|
Praetorium
(Wohnhaus des Kommandanten)
Dieses Haus
stand den Stadthäusern der priviligierten
Schichten in nichts nach. So konnte der Kommandeur
und seine Familie auch am Limes ihren gewohnten
Luxus nahezu aufrechterhalten. |
|

[59]
|
Horreum
(Speicherhaus)
Hier wurden
die Lebensmittel gelagert, vor allem das Getreide.
Der Fußboden war auf Pfeilern aufgeständert, so
dass die Luft unter dem Boden zirkulieren konnte.
So blieben die gelagerten Waren trocken und
verdarben nicht so schnell. |
Valetudinarium
(Lazarett)
Unter Kaiser
Augustus wurde in allen größeren Militärlager
ein Sanitätsdienst mit eigenen Militärärzten
etabliert. Die Ärzte und das Sanitätspersonal (capsarii,
marsi) waren nicht in Form eines eigenes
Sanitärkorps wie heute aufgestellt sondern über
alle Waffengattungen verteilt. Sie waren in einem
Lazarett stationiert. Das römische Lazarett war
ein einstöckiger Bau mit einem Innenhof, der
durch das Haupttor leicht zu erreichen war. Dieser
Innenhof diente als Sammelplatz für Verwundete
und Gerät. Zentrum des Lazarett waren neben dem
vermutlichen Operationssaal im Eingangstrakt die
Korridore mit den Krankenstuben. Zwischen Korridor
und Krankenstube war ein kleiner Windfang
angeordner, in dem vermutlich auch das gebrauchte
Material oder Geräte gelagert werden konnten.
Schon in Kohortenkastellen hat man Lazarette
gefunden. Die Spuren des ältesten nachweisbaren
römischen Lazaretts fand man im Militärlager von
Haltern an der Lippe. |
|
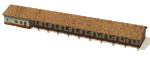
[59]
|
Centuria
(Unterkünfte/Baracken)
Je Kammer war
eine Zeltgemeinschaft (der Begriff kommt aus dem
Marschlager) von 8 Soldaten untergebracht. Im
größeren Bau am Kopf der Baracke wohnten die
Offiziere, wie der Centurio.
|
|
In
den Reiterkastellen gab es daneben noch
zusätzlich an den Unterkünften die Ställe (stabulum)
für die Pferde.

Abbildung
einer Reiterbaracke in einem Kastell
|
| Fabrica
(Werkstätten) und fabricula (Magazine oder
Lagerräume) |
| Im
römischen Heer gab es viele gut ausgebildete
Handwerker. Diese sogenannten immunes (Gefreiten)
waren vom normalen Militärdienst befreit. Je nach
Größe des Kastell/Lager gab es Erdarbeiter,
Baumeister, Schiffbauer, Geschützbauer,
Glasmacher, Schmiede, Waffenbauer,
Rüstungsmacher, Wagenbauer, Wasserbautechniker,
Bogenmacher, Klempner, Maurer, Kalkbrenner,
Holzfäller, Köhler und viele andere mehr. Dem
entsprechend gab es passend ausgestattete
Werkstattgebäude (fabrica) und Lagerräume (fabricula)
für die vielfältigen Ausrüstungsgegenstände
sowie für Geräte, Wagen und sonstige Vorräte. |
Kastellbad
Der Besuch der aufwendigen Bäder war auch ein
fester Bestandteil des damaligen Lagerlebens. Er
begann wie in zivilen Thermenanlagen im Schwitzbad
(sudatorium), setzte sich im Lauwarmbad (tepidarium)
fort, in dessen Wasserbecken man sich auch wusch.
Danach folgte das Warmbad (caldarium), welches vor
allem der Entspannung diente und abgeschlossen
wurde der Badegang im Kaltbad (frigidarium). Daher
war auch die Aufteilung dieselbe wie bei zivilen Thermenlagen.
Die Kastellthermen befanden sich in der Regel
außerhalb der Lagermauern in der Nähe eines der
Tore. Daher konnte die Anlage auch von Zivilisten
des nahegelegenen Kastellvicus genutzt werden. |
Amphitheater
 |
Nach
neuesten Funden (Amphitheater des
Kohortenlager bei Künzing im Jahre 2003,
siehe Bild links) wird vermutet, dass auch
kleinere Militäranlagen, wahrscheinlich
aber nahezu alle Kohortenkastelle ein
kleines Amphitheater oder Theater hatten.
Diese waren nicht wie die in den Städten
aus Stein gebaut, sondern wurden in
Holz-Erde-Bauweise oder unter Ausnutzung von
Hanglagen errichtet. Ein gutes Beispiel für
diese Bauweise von Amphitheatern ist das in
Birten noch heute sichtbare Amphitheater des
Legionslager Castra Vetera I. Man hatte auch
beim Militär sehr wohl erkannt, dass gute
Stimmung vor allem an der Kriegsfront
wichtig war für den militärischen Erfolg.
Daher bildete die Unterhaltung der
Legionäre gerade in den Grenzgebieten,
abseits der städtischen Zentren, einen
bedeutenden Aspekt bei der Planung der
Militäranlagen, insbesondere hinsichtlich
der Errichtung von Thermen und Theatern. |
|
| |
|
|
| Wehranlagen |
| Verteidigungsgräben
(fossae) |
| Die
Kastelle waren rundum von ein oder mehreren Gräben, den
sogenannten Spitzgräben umgeben. Die häufigste Form
waren die Doppelspitzgräben. Vor den Toren waren die
Gräben entweder durchbrochen (Erdbrücken als
Zufahrtswege) oder wurden von hölzernen Brücken
überspannt. Die Gräben dienten der Auflockerung von
geschlossenen Angriffsformationen sowie der Behinderung
des Heranbringen von Belagerungsgerät an die Wehrmauer.
Die Breite der Gräben schwankte zwischen 2,5 und 6
Meter. Bei Kastellen mit nur einem Graben war dieser in
der Regel zwischen 3,5 und 5 Meter breit. Bei zwei oder
mehr Gräben waren die einzelnen Gräben eher schmaler.
Die Tiefe der Spitzgräben lag zwischen 1,2 und 3
Metern. Die Breite der gesamten Grabenzone (Außenkante
Wehrmauer bis Außenkante des äußeren Graben) war
bestimmt durch die Schußweite der Verteidigungswaffen.
Bei der Verwendung von Wurfspeeren (der häufigsten
Waffe von Auxiliartruppen) waren es 15 bis 25 Meter. War
die im Kastell stationierte Einheit mit den weiter
reichenden Pfeilbögen oder Handschleudern ausgestattet,
dann war der Bau mehrerer Grabensysteme durchaus
sinnvoll. Wurfmaschinen wie Pfeilgeschütze (scorpiones)
oder Steinschleudern (ballistae) gab es 1. und 2.Jrh nur
bei Legionslagern. Erst im 3. Jrh. fanden diese auch in
Lagern der Hilfstruppen Verwendung. |
| Annäherungshindernisse |
| Als
zusätzlich Hindernisse kamen Reihen mit zugespitzte
Pfählen, dornigen Ästen oder aber abgedeckte
Fallgruben mit angespitzen Hölzern darin (lilia) zum
Einsatz. |
| Wehrmauer
und Türme |
| Erde
oder Rasensodenmauer (vallum) |
|
Die
Erde zum Wall stammt größtenteils aus dem Aushub
des oder der Verteidigungsgräben um das Kastell.
Als Basis dienten in den Boden gerammte
Rundhölzer oder Steinschichtungen, um den
Wallkörper durch eine gute Drainage vor dem
Einsturz zu bewahren. Als senkrechte Frontseite
finden wir entweder Holzpalisaden oder wiederum
Rasensoden. Bei diesem Mauertyp wurden die Eck-und
Zwischentürme in Holzbauweise errichtet. Man
spricht bei derart befestigten Kastellen von
Holz-Erde-Bauweise. Diese war meistens die erste
Ausbaustufe eines Kastell (1.
bis Anfang 2.Jrh.).
Später wurde viele in Steinkastelle umgewandelt. |
| Steinumwehrung
(murus) |
|
Hinter
der aus Stein errichteten Mauer befand sich
meistens ein aufgeschütteter Erdwall, der als
Wehrgang genutzt wurde. Es gab aber auch Kastelle
mit freistehenden Mauern. Passend dazu waren die
Eck- und Zwischentürme in Steinbauweise
ausgeführt. |
|
|

[59]
|
Porta
(Tor)
Jedes größere Kastell hatte vier Tore: porta
praetoria (das Haupttor), porta decumana (das
hintere Tor), porta principalis dextra (rechtes
Tor der via principalis) sowie porta principalis
sinistra (linkes Tor der via principalis). Die
Angaben für links und rechts beziehen sich dabei
auf den Blick vom Stabsgebäude in Richtung des
Haupttores.
|
| In
der ersten Bauphase (1. bis Anfang 2.Jrh.) war
anstelle der Mauer ein Erdwall und die Tore waren
vermutlich aus Holz errichtet, wie bei den
gefundenen Standlagern an der Lippe (z.B. Anreppen
und Haltern). Mitte des 2. Jrh. wurde die Kastelle
in Steinbauweisen umgebaut, der Wall wurde durch
eine Mauer ersetzt und es wurde Steintore
errichtet. Außerdem wurden die größeren
Standlager, so auch die Kastelle, fast immer mit
dem typischen Doppelspitzgraben, zu mindestens
aber mit einem einfachen Spitzgraben, umgegeben. |
|
|
| |
| Lagerstrassen |
| Via
principalis |
|
| Verband
die porta principalis sinistra (linkes Seitentor) mit
der porta principalis dextra (rechtes Seitentor) |
| Via
praetoria |
|
| Sie
führte von der principia (Stabsgeäude) zur porta
praetoria (vorderes Haupttor) |
| Via
decumana |
|
| Sie
führte von der Rückseite der principia (Stabsgeäude)
zur porta decumana (rückwärtiges Tor) |
| Via
sagularis |
|
| Sie
war die hinter der Mauer oder dem inneren Erdwall
umlaufende Wallstrasse. Sie diente dem schnellen
Erreichen der Wehranlagen im Alarmfall oder dem Ein- und
Ausrücken der Truppen. |
| Via
Quintana |
|
| Parallel
zur via principalis verlaufendeStrasse hinter der
principia, die bei vielen Kastellen zusätzlich
vorhanden war. |
|
| |
| Kastellvicus |
| Zu jeden
größeren Militärlager gehörten auch Zivilisten, die als
Händler, Handwerker, Schankwirte, Tänzerinnen oder Dirnen
den Soldaten ihre Dienste anboten. Außerhalb der
Ausfallstrassen der Militärlager entstanden daher die
Kastelldörfer (vici). Mit zunehmender Anzahl von ansässigen
Zivilisten wurden diese Dörfer zu Verwaltungs- und
Wirtschaftszentren für ihr Umland. Einige dieser vici
entwickelten sich zu Städten und wurden Hauptorte ihres
Verwaltungsbezirkes. In den lokalen Werkzeugschmieden oder
Bronzegießereien versorgten sich nicht nur die Einwohner
sondern die Armee bezog bei Ihnen auch einen Teil ihrer
Ausrüstung. Zimmerer und Schreiner waren in jeden Kastelldorf
vertreten. Eine zentrale Funktion der Dörfer war aber auch
der Umschlag sowie die Weiterverarbeitung von auf den
umliegenden Gutshöfen (villa rustica) erzeugten
landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide, Obst, Gemüse und
Fleisch aber auch Wein oder von importierten Gütern wie Öl
und Fischsauce. Die Bebauung dieser Dörfer war immer
ähnlich. Wichtiger Bezugs- und Ausgangspunkt bei der Bebauung
war die aus dem Kastell kommende Strasse, an der anfänglich
alle Häuserparzellen einen rechteckigen Anteil erhielten. Die
darauf gebauten Streifenhäuser
wurden meist in Fachwerkbauweise errichtet und besaßen zur
Strasse hin einen Laden (tabernae) mit einer vorgelagerten
überdachten Porticus. An die Wohnräume im hinteren Hausteil
schloss sich ein Hof an, in dem der Brunnen, die Latrine aber
auch handwerkliche Einrichtungen errichtet wurden. In der
Nähe zum Kastelltor lagen Gebäude wie das Kastellbad
oder (bei Vorhandensein) das Amphitheater. |
|
|
|
|
|
Wachttürme  |
| Aufbau
und Funktion |
| Eines
der wesentlichen Elemente des Limes waren die etwa 900
Wachttürme. Sie waren in Sichtweite zueinander aufgestellt.
Bereits in der 1.Limesbauphase, als lediglich eine Schneise
durch die Wälder geschlagen worden war, waren innerhalb
dieser Schneise bereits stabile Türme aus Holz errichtet
worden. |
|
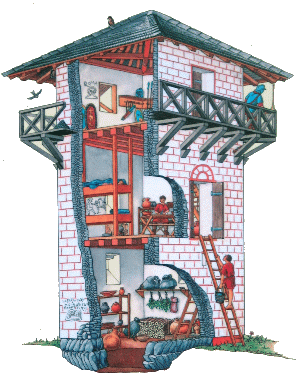
[101]
Querschnitt durch einen steinernen Wachturm
|
Später
wurden diese vielerorts in der Mitte des 2.Jrh. durch feste
Steintürme ersetzt. Die Wachtürme bestanden im Inneren aus
drei Ebenen. In der untersten wurden die Vorräte an
Nahrungsmitteln u.ä. gelagert. Die mittlere Ebene war der
Schlaf- und Wohnraum der Soldaten. Hier befand sich auch die
Eingangstür, welche von außen nur über eine steile Treppe
erreichbar war. In der obersten Ebene war der Wachraum, wo die
Soldaten ihren Dienst versahen. Von dort konnten sie auf eine
umlaufende Brüstung treten. Von hier hatte man in alle
Richtungen einen weiten Blick ins Land. Im Falle eines
Angriffes konnten sich die Wachtmannschaften in den Türmen so
lange halten, bis Verstärkung aus den umliegenden Kastellen
eingetroffen war. Diese wurde durch Rauchzeichen, Feuer- oder
Hornsignale von Turm zu Turm und letztendlich bis zu den
nächsten Kastellen alarmiert.
|
| |
|
|
|
|
|
|